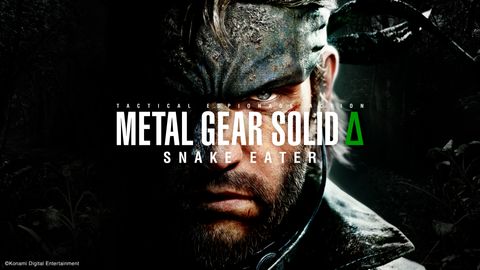„In die Sonne schauen“: Filmkritik, Bewertung und Kino-Start des deutschen Oscar-Beitrags
Deutschlands Oscar-Beitrag startet am 28. August im Kino. Unsere Filmkritik zu „In die Sonne schauen“ verrät, warum das Drama trotz Arthouse-Anspruch mitten ins Herz trifft.

Deutschlands offizieller Beitrag für den Oscar für den besten internationalen Film startet am 28. August. Unsere Rezension zeigt, warum „In die Sonne schauen“ mehr ist als klassisches Arthouse-Kino und wie der Film in Cannes bereits Kritikerinnen und Kritiker überzeugte.
„In die Sonne schauen“ als deutscher Oscar-Beitrag 2026
Wenn ein deutscher Film ins Rennen um den Oscar geschickt wird, ist die Aufmerksamkeit groß. Mit „In die Sonne schauen“ hat sich die Jury von German Films in diesem Jahr für ein Werk entschieden, das Mut beweist und schon bei seiner Premiere in Cannes für Furore sorgte. Mascha Schilinskis Drama eröffnete die 78. Internationalen Filmfestspiele und wurde dort mit dem Preis der Jury ausgezeichnet – ein deutliches Signal, dass die Regisseurin mit ihrer kompromisslosen Handschrift international wahrgenommen wird.
Handlung und Themen von „In die Sonne schauen“
Der Film ist alles andere als klassische Unterhaltung. Schilinski erzählt die Geschichte einer Familie auf einem Bauernhof in der Altmark, doch sie tut es nicht linear, sondern in einem assoziativen Erinnerungsstrom. Über vier Generationen hinweg begleitet das Publikum Frauen, die auf unterschiedliche Weise mit häuslicher Gewalt, vererbten Traumata und unerfüllten Sehnsüchten ringen. Aus dieser Struktur entsteht ein filmisches Mosaik, das die Grenzen von Zeit und Raum verschwimmen lässt und dennoch berührend nah an den Figuren bleibt.
Arthouse-Kino mit Emotionen für ein breiteres Publikum
Viele Kinogänger:innen verbinden Oscar-Beiträge automatisch mit schwer zugänglichem Arthouse-Kino. Tatsächlich ist „In die Sonne schauen“ formal anspruchsvoll: Die Kamera arbeitet im 4:3-Format, das Sounddesign macht Naturgeräusche und Stille zur eigenen Erzählebene, die Montage springt mutig zwischen Epochen und Emotionen. Doch gleichzeitig gelingt es Schilinski, die Zuschauer:innen mitten ins Geschehen hineinzuziehen. Die Gefühle, die in den Gesichtern der Darstellerinnen aufblitzen – Verzweiflung, Hoffnung, Liebe, Wut – sind so unmittelbar, dass man sich ihnen kaum entziehen kann.
Darstellerinnen, Cast und visuelle Kraft
Getragen wird das Drama von einem starken Ensemble. Hanna Heckt, Lea Drinda, Lena Urzendowsky und Laeni Geiseler verkörpern die verschiedenen Generationen der Familie mit einer Intensität, die lange nachhallt. Auch Luise Heyer und Susanne Wuest fügen dem Film zusätzliche Nuancen hinzu und verstärken die emotionale Dichte. In Kombination mit der präzisen Inszenierung entsteht eine Erfahrung, die nicht nur analytisch beeindruckt, sondern vor allem tief bewegt.
Filmkritik und Bewertung: Unser Fazit zu „In die Sonne schauen“
Gerade darin liegt die besondere Stärke des Films: Er ist ohne Frage ein Werk des Arthouse-Kinos, doch er bleibt nicht elitär. Wer sich auf den Fluss der Bilder und Klänge einlässt, erlebt eine Geschichte, die weit über ihre kunstvolle Form hinaus wirkt. Die Themen von Gewalt, Erinnerung und familiärer Bindung sind universell und lassen „In die Sonne schauen“ weit mehr sein als ein Festival-Film für Expert:innen.
Als deutscher Oscar-Beitrag 2026 hat Schilinskis Werk damit alle Voraussetzungen, um international Aufmerksamkeit zu erregen. Schon der Jury-Preis in Cannes zeigt, dass die künstlerische Handschrift geschätzt wird und die emotionale Direktheit könnte auch über Fachjurys hinaus wirken.
Unsere Bewertung: 4 von 5 Sternen. „In die Sonne schauen“ ist kein leichter Film, aber ein eindrucksvolles Erlebnis, das im Gedächtnis bleibt. Ein Drama, das zeigt, dass Arthouse-Kino nicht abgehoben sein muss, sondern mitten ins Herz treffen kann und damit ein würdiger Kandidat für den größten Filmpreis der Welt.
Quellen
German Films
Festival de Cannes
Filmdienst
Kino-Zeit